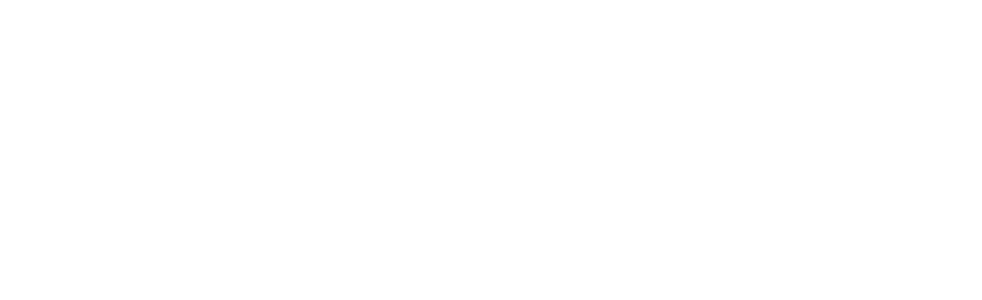Nicht nur private Eigentümer, sondern auch Pensionskassen und institutionelle Investoren lassen derzeit im Eiltempo ihre Mehrfamilienhäuser in Stockwerkeigentum umwandeln und «strählen» ihre Portfolios, bevor neue Restriktionen greifen.
Der Auslöser ist eine Reihe linker Initiativen, die ein kommunales Vorkaufsrecht für Gemeinden fordern und zusätzlich ein Verbot der Umwandlung von Mietliegenschaften in Stockwerkeigentum ermöglichen wollen. Konkret zielt die sogenannte WohnschutziInitiative darauf ab, den Gemeinden im gesamten Kanton Zürich die gesetzliche Grundlage zu geben, solche Umwandlungen künftig zu untersagen.
Mehr zur Initiative auf wohnraum-schuetzen.ch
Was harmlos nach «mehr Schutz für Mieter» klingt, hat Nebenwirkungen. Denn wer umwandelt, kann deutlich über dem Ertragswert verkaufen und umgeht zugleich ein mögliches Vorkaufsrecht, das vielleicht schon ab November gilt. Und Hand aufs Herz: Welche Gemeinde kauft schon einzelne Eigentumswohnungen, wenn sie nicht das ganze Haus besitzen kann?
Die Folgen sind hektische Notariate, überlastete Architekturbüros und Treuhänder im Dauerlauf. Überall wird gerechnet, gezeichnet und beurkundet, bevor die neue Gesetzeslage Fakten schafft.
Darf man eigentlich immer umwandeln?
Bei der Begründung von Stockwerkeigentum gelten technische Mindestanforderungen, unter anderem gemäss SIA-Norm 181 (Schallschutz). Wenn beispielsweise eine ältere Mietliegenschaft in Stockwerkeigentum aufgeteilt wird, müssten eigentlich die erhöhten Schallschutzanforderungen für Eigentumswohnungen erfüllt werden.
Das kann dazu führen, dass eine Umwandlung technisch oder wirtschaftlich kaum machbar ist, weil Böden, Decken und Trennwände saniert werden müssten. In der Praxis wird dies oft «kulant» gehandhabt, formal bleibt es aber eine rechtliche Grauzone (eine Baubewilligung ist nicht erforderlich).
Können Gemeinden immer ein Vorkaufsrecht ausüben?
Gemäss dem Initiativtext könnten Gemeinden künftig innerhalb von 60 Tagen nach Beurkundung ihr Vorkaufsrecht ausüben, sofern das Zürcher Stimmvolk Ende November zustimmt.
Auf dem Papier klingt das einfach. In der Praxis ist es jedoch fraglich, ob Gemeinden finanziell und organisatorisch überhaupt dazu in der Lage sind. Zum einen bestehen Ausnahmen, etwa bei Eigengebrauch durch den Käufer, was bei Wohneigentumstransaktionen häufig der Fall ist. Zum anderen geben viele Gemeindeordnungen gar nicht die nötige finanzielle Autonomie, um Liegenschaften ohne Zustimmung der Gemeindeversammlung zu erwerben. Und diese kann nicht im 60-Tages-Takt einberufen werden.
Hier zeigt sich, dass die Initianten ihre Vorlage nicht bis zum Ende durchdacht haben. Rechtlich und operativ bleibt vieles unklar.
| Gemeinde | Limite ohne Gemeindeversammlung (GV) | Bemerkungen | Quelle/Stand |
|---|---|---|---|
| Zollikon | CHF 1 000 000 | Gemeindeordnung Zollikon (2022) | |
| Küsnacht | CHF 10 000 000 (Finanzvermögen) / CHF 2 000 000 (Verwaltungsvermögen) |
Unterschied zwischen Finanz- und Verwaltungsvermögen | Gemeindeordnung Küsnacht (2022) |
| Erlenbach | CHF 4 000 000 (Finanzvermögen) | Bis CHF 4 Mio ; Investitionen bis CHF 2 Mio | Gemeindeordnung Erlenbach (2023) |
| Schlieren | CHF 2 000 000 (Verwaltungsvermögen) / CHF 5 000 000 (Finanzvermögen) | gemäss Gemeindeordnung 2021 | Gemeinde Schlieren, GO 2021 |
Fazit
Selbst wenn das Vorkaufsrecht kommt, könnten viele Gemeinden es derzeit faktisch gar nicht umsetzen. Dazu müssten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zuerst die jeweilige Gemeindeordnung anpassen und neu verabschieden.
Moral der Geschichte
Was als «Wohnraumförderung» gedacht ist, bewirkt das Gegenteil. Durch die drohenden Einschränkungen verschwinden Mietwohnungen, während mehr Eigentumswohnungen entstehen. Damit sinkt die Hürde für spätere Verkäufe, denn jede Wohnung kann einzeln und oft nach einem Mieterwechsel veräussert werden.
Die geplante Initiative wirkt somit wie ein Bremsklotz für den Mietwohnungsmarkt. Sie zeigt, was passiert, wenn man Wohnpolitik mit Misstrauen statt mit Anreizen betreibt: Es wird mehr Eigentum geben, aber weniger bezahlbare Mietwohnungen.
Mehr zur politischen Grosswetterlage im Immobiliensektor finden Sie in unserem aktuellen Beitrag: Ein heisser November steht bevor